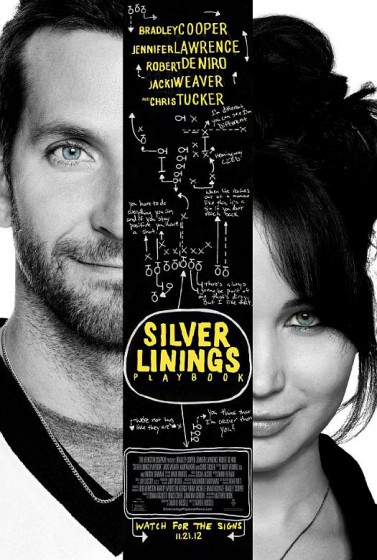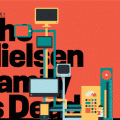Lucy Hay stellt auf ihrem Blog Bang2Write eine hervorragende Frage: Muss die Hauptfigur in einer Geschichte zwingend eine Charakterentwicklung durchmachen? Muss sie etwas wichtiges lernen, an der Geschichte “wachsen”, um am Ende jemand anderes, “besseres” zu sein, als am Anfang?
Wer einmal einen Drehbuchschreibkurs oder ein Dramaturgie-Buch gelesen hat, wird diese Fragen reflexartig mit “Ja” beantworten.
Lucy Hay nennt in ihrem lesenswerten Beitrag jedoch einige prominente Filmbeispiele, die völlig ohne Figurenentwicklung auskommen: Ripley in “Alien”, McClane in “Die Hard” oder Forrest Gump. In der Tat dürfte die statische Hauptfigur in den meisten Action- und Superheldenfilmen eher die Regel als die Ausnahme sein. Auch in Komödien kommen immer wieder statische Hauptfiguren vor, etwa Harry and Lloyd in “Dumb and Dumber” oder Jeff Lebowski in “The Big Lebowski”. Auch in “Fargo” lernt keine der Hauptfiguren erkennbar etwas hinzu.
Die charakterliche Entwicklung der Hauptfigur ist sicherlich für viele Geschichten von zentraler Bedeutung. Aber wie die Beispiele zeigen eben nicht immer.
Trotzdem wird das Mantra “Eine Hauptfigur muss an der Geschichte wachsen” jedem angehenden Autor – und schlimmer noch Nicht-Autor – ständig und überall eingetrichtert. Warum auch nicht? Charakterentwicklung schadet schließlich nie. Oder?
Meine Antwort darauf wäre: meistens nicht. Aber manchmal macht sie die Geschichte auch nicht besser. Ein gutes Beispiel dafür ist Alfonso Cuaróns “Gravity”: hätte der Film nicht auch ohne die bemühte Überwindung des Muttertraumas von Sandra Bullocks Figur Stone hervorragend funktioniert? Hätte er nicht vielleicht sogar besser funktioniert, weil durch eine weniger psychologisch angeschlagene Figur die Glaubwürdigkeit der Geschichte nicht so stark strapaziert worden wäre? (Warum um alles in der Welt wird eine Frau, die psychisch derart labil ist, auf eine Weltraummission geschickt?!?)
Vor allem aber kann ein zu starker Fokus auf Figurenentwicklung bei der Entwicklung einer Geschichte, die stark über die äußere Handlung funktioniert auch hinderlich sein. Wir alle kennen diese Figuren, die mit komplexen persönlichen Konflikten in eine Geschichte gehen und diese damit einfach nur überfrachten. Weniger ist manchmal mehr.
Wenn man eine gut funktionierende, spannende oder lustige Geschichte hat und bei der Entwicklung feststellt, dass die Hauptfigur keine wirkliche Entwicklung durchmacht, sollte man nicht gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Vielleicht braucht diese Geschichte dann einfach keine Charakterentwicklung.
Wie Lucy Hay völlig richtig feststellt, ist eine charakterliche Entwicklung der Hauptfigur nicht das erzählerische Allheilmittel, als dass es von den meisten Schreibratgebern dargestellt wird. Sie wird in der Tat seit einigen Jahren deutlich überstrapaziert. Wenn ein starker, konfliktreicher Plot vorhanden ist, ist es manchmal besser, den Helden zwischen all der Action nicht auch noch sein Kindheitstrauma aufarbeiten zu lassen.