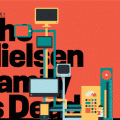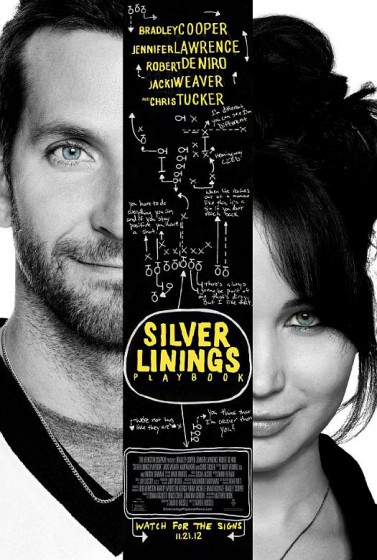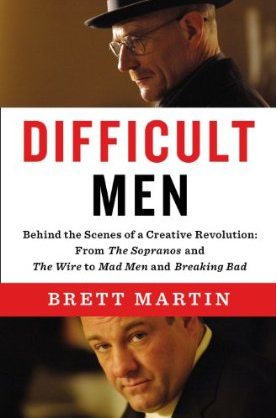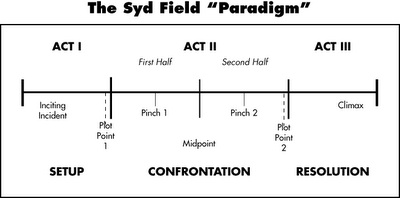Ist Science Fiction und Fantasy ein rein westliches Phänomen? Christine Folch vergleicht in einem Essay im Atlantic die vorherrschenden Film-Genres Hollywoods mit denen Bollywoods und stellt die Frage: Warum sind vor allem die westlich geprägten Gesellschaften offenkundig so von Science Fiction und Fantasy fasziniert?
Folch zitiert den deutschen Soziologen Max Weber mit seiner Theorie, dass wir in einer “entzauberten Welt” leben, in der es für alles eine Erklärung gebe und die sei schlicht und einfach langweilig. Umso stärker sei dann die Sehnsucht nach Magie, Mystik und Unerklärbarem.
Da mag etwas dran sein. Allerdings muss man feststellen, dass auch das europäische Kino herzlich wenig an Fantasy und Science Fiction hervorbringt – was aber eher ein Problem der fehlenden Budgets ist als ein Mangel an Interesse des Publikums, wie die eindrucksvollen Besucherzahlen vor allem der amerikanischen Fantasy-Filme beweisen.
Obwohl Bollywood nach Anzahl produzierter Filme Hollywood als Filmhauptstadt der Welt weit in den Schatten stellt – bei den Budgets ist Tinseltown immer noch König. Es ist schwer vorstellbar, dass die indische Filmindustrie mit den Special-Effects-Schlachten aus Kalifornien mithalten könnte.
Allerdings ist es bemerkenswert, dass die großen Science Fiction und Fantasy Hits aus Amerika in Indien keine nennenswerten Zuschauerzahlen erzielen konnten. Vielleicht ist also wirklich etwas dran, an der westlichen Faszination an fiktiven magischen Welten. Auch wenn das europäische Kino für die die notwendigen Budgets nicht auftreiben kann – eine große Zahl äußerst erfolgreicher europäischer Fantasy-Roman-Autoren beweist, dass die Sehnsucht nach Verzauberung auch in Europa groß ist.