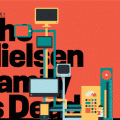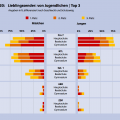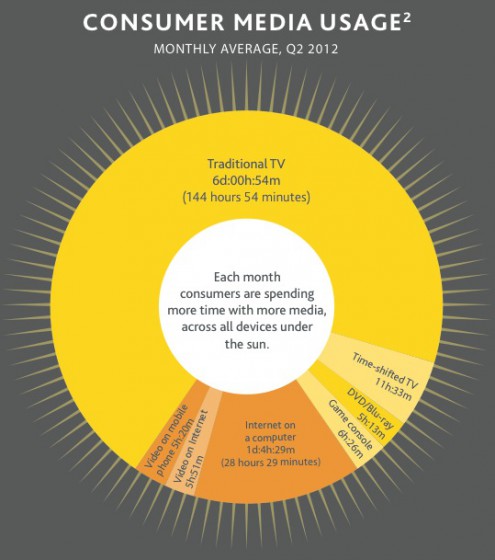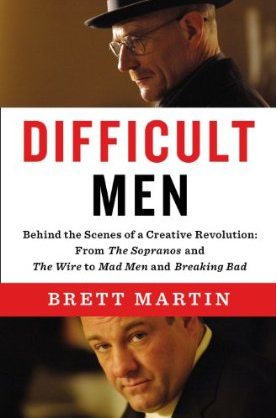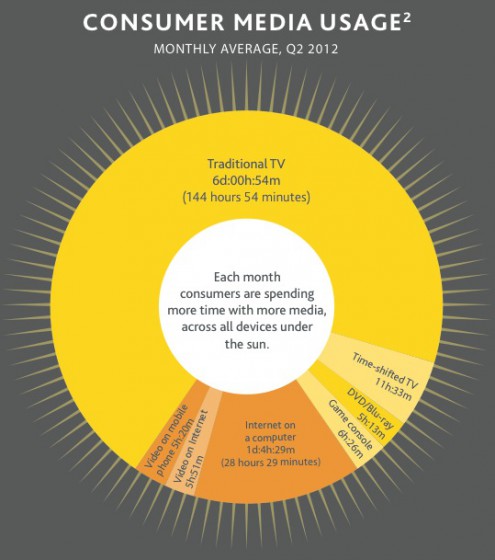Zum Amtsantritt des neuen WDR-Intendanten Tom Buhrow stellt Norbert Schneider in der FAZ die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der üblicherweise mit Journalisten besetzten Führung öffentlich-rechtlicher Sender und der schwachen Stellung der Fiktion, vor allem der Serie, bei ARD und ZDF gibt.
Dabei weist er auf einen wunden Punkt hin, der in der Diskussion in der Tat oft vernachlässigt wird:
“Wenn man sich Serien wie „Mad Men“ in Deutschland produziert nicht vorstellen kann, dann gibt es sie zunächst deshalb nicht, weil es die Bücher nicht gibt. Die aber gibt es vor allem deshalb nicht, weil die Drehbuchautoren (und die Produzenten) sich den zeitlichen Vorlauf, der nötig wäre, nicht leisten können. Und warum? Das können sie deshalb nicht, weil das System, das sich diese Serien finanziell locker leisten könnte – schließlich ist es das reichste der Welt -, weil das System sie sich nicht leistet. Nicht einmal: sich nicht leisten will. Sondern viel einfacher: sich nicht leistet. Weil es keinen gibt, der sich der Sache derart annimmt, dass sie etwas werden könnte.”
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Herstellung fiktionaler Programme eigenen Gesetzen folgt, die sich vom sonstigen Fernsehgeschäft stark unterscheiden – vor allem hinsichtlich der Zeit, die es braucht, um sie zu realisieren. Während ein Journalist gewohnt ist, in Zeiträumen von Tagen, Wochen oder bestenfalls Monaten zu denken, ist allein die Entwicklung guter Drehbücher oft eine Sache von Jahren – eine Zeit, die den Machern im schnelllebigen Fernsehgeschäft viel zu selten zugestanden wird. Das Ergebnis sind unterentwickelte Drehbücher, halbgare Geschichten und wenig aufregende Filme und Serien.
Schneider kommt zu dem Schluss, dass das fiktionale Programm im deutschen Fernsehen keine starke Lobby hat und fordert ein Umdenken. Wenn wir nicht immer neidisch nach Amerika oder – paradoxerweise – Schweden oder Dänemark schielen wollen, muss das Fiktionale und speziell die stiefmütterlich behandelte Serie zur Chefsache werden. Wahre Worte.