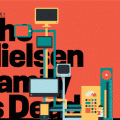Der eigentliche Zweck des Urheberrechts, nämlich den Urheber zu schützen und ihm für seine schöpferische Tätigkeit ein Auskommen zu sichern, ist in der Praxis längst ausgehebelt worden. Das gilt besonders für die Filmbranche. Ein Autor, der einen Drehbuchvertrag unterschreibt, tritt mit seiner Unterschrift de facto sämtliche Rechte an seinem Werk ab und muss sich obendrein den Preis für seine Arbeit diktieren lassen. Gegen die Marktmacht der Fernsehsender hat der einzelne Autor keine Chance.
Selbst wenn sich Urheber in Berufsverbänden organisieren, läuft es für sie nicht unbedingt besser. Das hat sich in den Verhandlungen zu gemeinsamen Vergütungsregeln gezeigt, die der VDD über Jahre hinweg mit dem ZDF geführt hat. Das Ergebnis war so ernüchternd, dass sich eine Schar wütender Drehbuchautoren, die bislang nicht im VDD waren, unter dem Label NORAU zusammengetan hat, um geschlossen in den Verband einzutreten. Das erklärte Ziel: die Vereinbarung mit dem ZDF schnellstmöglich zu kündigen.
Selbst wenn das geschähe, stellt sich immer noch die Frage, wie eine bessere Vereinbarung mit den Sendern zu erzielen wäre – schließlich hat der VDD über Jahre hinweg hartnäckig verhandelt. Das Ergebnis war offenbar das Beste, was herauszuholen war. Ein Berufsverband wie der VDD ist eben keine Gewerkschaft mit Pflichtmitgliedschaft wie die Writer’s Guild in den USA, die mit einem Streik ganz Hollywood lahmlegen kann. Schon allein deshalb sind die in der letzten Urheberrechtsreform geforderten Gemeinsamen Vergütungsregeln offenkundig kein geeignetes Mittel, einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der Urheber und der Verwerter zu schaffen.
In der Süddeutschen Zeitung hat Drehbuchautor Fred Breinersdorfer jetzt einen äußerst interessanten Vorschlag veröffentlicht, der das Potential hat, diese festgefahrene Diskussion nachhaltig zu verändern. Seiner Meinung nach sollten Filme durch eine Urheberrechtsreform nach einer bestimmten Sperrfrist eine Internet-Zwangslizenz erhalten. So verrückt wie das klingt, ist das gar nicht. Vorbild für diesen Vorschlag ist die existierende Zwangslizenz für das Nachspielen von Musikstücken: Jeder kann veröffentlichte Musiktitel nachspielen – er muss nur den Urheber an seinen Erlösen angemessen beteiligen. Dafür zahlt er Gebühren an die GEMA.
Wie wäre es also mit einer Film-GEMA für im Internet verbreitete Filme? Und vielleicht nicht nur Kino-, sondern auch Fernsehfilme?
Der unbestrittene Charme von Fred Breinersdorfers Idee besteht darin, dass sie die üblichen Rechteverwerter außen vorläßt, die es mit ihrer eifersüchtigen Rechte-Heimserei nicht schaffen, ein umfassendes, legales Angebot für Filme im Internet auf die Beine zu stellen, nur um damit das Feld illegalen Streaming-Plattformen zu überlassen, mit denen sich zwielichtige Gestalten eine goldene Nase verdienen, während die Urheber in die Röhre gucken.
Aus Sicht eines Piraten bringt es Bruno Kamm auf seinem Blog schön auf den Punkt:
“Fred Breinersdorfer hat mit seinem Vorstoß die Verwerterindustrie entwaffnet, ihnen das Weihwasser im Kampf gegen den freien Zugang zu Kultur genommen, denn er fordert Urheberrechte für die Urheber und nimmt dabei den Verwertern das Kernargument ihres Kreuzzuges gegen die Piraterie: Das Urheberrecht.”
Wobei Fred Breinersdorfers Vorschlag eben gerade nicht darin besteht, alles im Internet kostenlos verfügbar zu machen. Es geht darum, einen legalen Markt nach dem Vorbild der Streaming-Plattformen zu schaffen, auf denen Erlöse durch Werbung oder Premium-Angebote erzielt werden, an denen die Urheber über eine Verwertungsgesellschaft direkt beteiligt werden.
Natürlich wird die Verwertungsindustrie alles daran setzen, eine Urheberrechtsreform, die mehr den Urhebern als den Verwertern nützt, zu verhindern. Das Spannende an Fred Breinersdorfers Vorschlag ist, dass er die dröge Debatte ums Urheberrecht auf die eigentlich zentrale Frage herunterbricht: Wie lässt sich ein Urheberrecht gestalten, das in erster Linie den Urhebern nützt anstatt den Verwertern?
Auch wenn Breinersdorfers Vorschlag wenig Aussicht hat, jemals Realität zu werden, hilft er vielleicht, die festgefahrene Debatte ums Urheberrecht neu zu beleben. Allein damit wäre viel gewonnen.